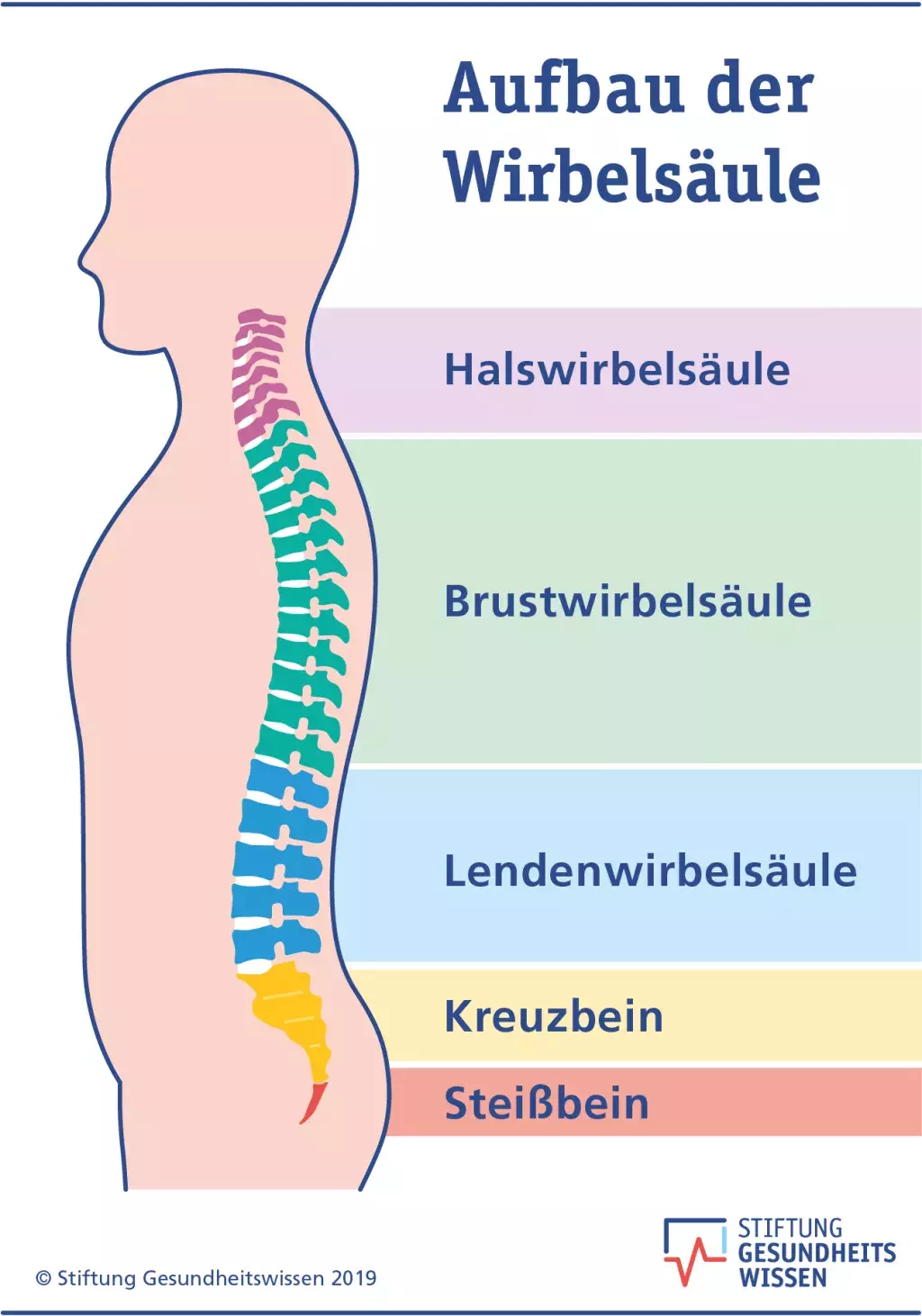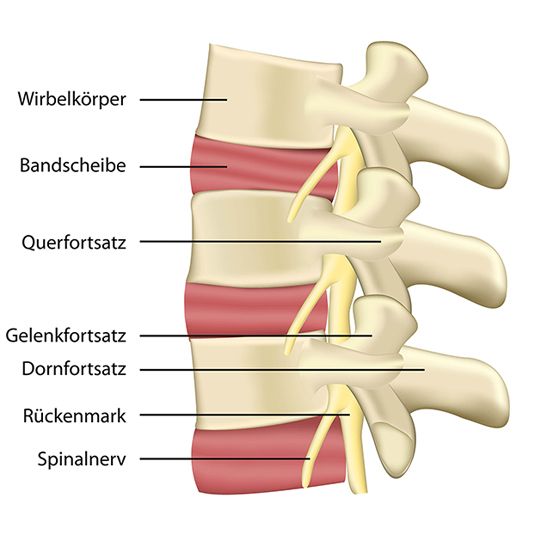Einleitung
Das ist Tim, er leidet seit einiger Zeit immer wieder unter starken Bauchschmerzen. Seine Mama geht deshalb mit ihm zum Arzt. Nach einigen Untersuchungen stellt dieser die Diagnose Reizdarmsyndrom. Tim und seine Mama sind ratlos? Was ist das? In diesem Blogbeitrag werden sowohl Tim und seine Mama als auch ihr über diese weit verbreitete Krankheit informiert!
Reizdarmsyndrom – Was ist das?
Das Reizdarmsyndrom (RDS), oft auch als
„nervöser Darm“ oder Reizkolon bezeichnet, gilt als eines der häufigsten funktionellen
gastroenterologischen Krankheitsbilder, welches sich durch typische Beschwerden
wie Bauchschmerzen, Verstopfung und Durchfall kennzeichnet (vgl. gesund.bund.de,
2020). Es handelt sich um eine ungefährliche, aber durchaus belastende und
meist chronische Erkrankung, die oft im Alter von 20 – 30 Jahren das erste Mal
auftritt und bei Frauen häufiger als Männern diagnostiziert wird. Schätzungsweise
leiden ca. 10 – 20 von 100 Menschen an einem Reizdarmsyndrom (vgl. ebd.). Ungefährlich
mach das RDS, dass die normale Organfunktion zwar gestört ist, es aber keine
Veränderungen der Organstrukturen gibt oder gar eine bösartige Krankheit als Ursache
der Beschwerden vorliegt (vgl. Nichterl 2021, S. 237).
Doch auch Kinder und Jugendliche können
bereits an einem Reizkolon leiden. Aus einer Metaanalyse geht eine weltweite
Gesamtprävalenz im Kindes- und Jugendalter von 8,8% für das RDS hervor. In Deutschland
belaufen sich die Zahlen bei Kindern im Alter von 6 – 10 Jahren auf 4,9 % (vgl.
Claßen 2018, S. 449).
Entstehung des
Reizdarmsyndroms
Die Entstehung des RDS hängt von
vielfältigen Einflussfaktoren ab. Neben genetischen Einflüssen können frühe
Traumata (z.B. postpartales Absaugen des Magens) und Erkrankungen (Henoch–Schönlein
Purpura, eine Entzündung der kleinen Blutgefäße) mit einem erhöhten Risiko für
das Reizdarmsyndrom einhergehen. Ein weiterer häufiger Auslöser des RDS sind
bakterielle Infektionen. (vgl. Claßen 2018, S. 450)
Schulmedizinisch gibt es jedoch noch
keine konkrete Erklärung für die Ursachen des RDS. Ein möglicher
Erklärungsansatz wäre eine Kommunikationsstörung zwischen Gehirn und Darm,
sowie falsche Ernährungsweisen. Aber auch genetische Ursachen oder Stress
werden immer wieder in Bezug auf das RDS genannt (vgl. Nichterl 2021, S. 238)
Typische Symptome
Die Symptome des Reizdarmsyndroms können stark variieren. Manche Betroffene leiden vor allem an anhaltenden Bauch- oder Unterleibsschmerzen und Krämpfen, andere unter Durchfall und wieder andere plagt eine chronische Verstopfung. Auch wechselhafte Stühle sind häufig (vgl. Nichterl 2021, S. 237). Des Weiteren können Blähungen, ein Völlegefühl, schleimiger Ausfluss sowie Veränderungen im Stuhlgangsmuster Anzeichen eines RDS sein (vgl. gesund.bund.de 2020).
Wie wird eine Diagnose gestellt?
Da es keine konkreten Symptome gibt, die
rein auf das RDS schließen lassen, erfolgt die Diagnose über die
Ausschlussdiagnostik. Hierbei werden andere Krankheiten des Magen-Darm-Traktes,
welche ähnliche Symptome zeigen, z.B. durch Laboruntersuchungen ausgeschlossen
(vgl. Nichterl 2021, S. 237f).
Wie kann das Reizdarmsyndrom behandelt
werden?
Das RDS ist nicht heilbar, die Therapie
zielt lediglich darauf ab die Symptome zu reduzieren. Hierbei spielen auch
äußere Faktoren, wie z.B. eine Ernährungsumstellung eine wichtige Rolle. Aber
auch Medikamente können kurzzeitig eingenommen werden, um Symptome wie Schmerzen
oder Durchfall zu behandeln (vgl. Dr. Kada Benotmane, o.D.) .
Eine Behandlung der betroffenen Personen
erfolgt immer individuell. Da sich bei jeder Person die Symptome anders äußern
können, gibt es kein allgemeingültiges „Erfolgsrezept“.
Als erfolgreich haben sich jedoch der
Verzicht auf einzelne Lebensmittel, die der Körper nicht gut verträgt und eine
damit einhergehende Ernährungsumstellung mit Ernährungsberatung herausgestellt
(vgl. ebd.).
Auch Entspannungsübungen, wie Yoga
können dem Körper helfen Stress abzubauen und somit die Symptome des RDS
vorzubeugen (vgl. Dr. Kada Benotmane, o.D).
Insgesamt sollte man beim RDS genau auf
seine Ernährung achten und auf seinen eigenen Körper hören.
Reizdarm im schulischen Kontext
In der Schule trifft man häufig auf Kinder,
welche unter dem RDS leiden. Jedoch bleibt dies für die Lehrkräfte meist
unbemerkt. Das Kind ist evtl. oft krank, muss häufiger auf die Toilette oder es
zeigt allgemeines Unwohlsein. Eine klare Kommunikation zwischen den Betroffenen
und den Lehrkräften ist hier wichtig, um das Kind weitestgehend unterstützen zu
können. Als Lehrkraft kann man dem Kind gegenüber den Druck nehmen und
unterstützend entgegenwirken.
Hierzu haben wir zwei Fragen zur
Anregung an euch:
Wie könnte diese Entlastung im
schulischen Kontext aussehen und wie könnte man Kinder mit RDS sonst
unterstützen?
Leidet ihr selbst unter RDS oder kennt ihr
jemanden? Falls ja, wie wurde bei euch/den Betroffenen mit der Situation
umgegangen?
Von
Christina Brobeil & Laura Lehmann
Literaturverzeichnis
Claßen,
Martin (2018): Reizdarm bei Kindern und Jugendlichen. In: Monatsschrift
Kinderheilkunde. 166 J./ Heft 5, S. 447 – 459.
Dr. Kada Benotmane, Boumediene (o.D.): Reizdarm /
Reizdarmsyndrom. info Medizin. [Online]: https://www.infomedizin.de/impressum/
[abgerufen am 16.01.2023].
Gesund.bund.de
(2020): Reizdarmsyndrom. [Online]: https://gesund.bund.de/reizdarmsyndrom [abgerufen am 12.01.2023].
Nichterl,
Claudia (2021): Integrative Ernährung. Ein ganzheitliches Konzept zur
Prävention und Ernährungstherapie. Berlin: Springer Verlag.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung
1: Schwabe Austria. From Nature. To Health. [o.J.]: Reizdarmsyndrom:
Darmstörung ohne Ursache. [Online]: https://www.schwabe.at/reizdarm/ [abgerufen am 16.01.2023].
Abbildung 2: Innovall (o.J.): Reizdarm: Ursachen, Symptome und wie man es behandelt! [Online]: https://innovall.de/ratgeber/reizdarm/reizdarmsyndrom/ [abgerufen am 16.01.2023].
Abbildung 3: AOK Hessen (2019): Reizdarmsyndrom: Die Top 5 der FODMAP-armen Lebensmittel. [Online]: https://www.presseportal.de/pm/117410/4323133 [abgerufen am 16.01.2023].